Polarisation
Die Polarisation von Licht spielt zum Beispiel bei Sonnenbrillen oder 3D-Filmen eine entscheidende Rolle. Was du dir unter Polarisation vorstellen kannst, erfährst du in unserem Video und diesem Beitrag!
Inhaltsübersicht
Polarisation einfach erklärt
Unter Polarisation kannst du dir die Schwingungsrichtung der elektrischen Feldvektoren von Licht vorstellen. Lichtwellen sind elektromagnetisch und bestehen somit aus Magnetfeldvektoren (B-Feld-Vektor) und elektrischen Feldvektoren (E-Feld-Vektor).
Beide Vektoren verlaufen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung von Licht, weshalb du Licht als Transversalwelle bezeichnest. Für die Polarisation ist aber nur der E-Feld-Vektor relevant. Den Betrag und die Schwingungsrichtung von E-Feld-Vektoren nennst du daher Polarisation.
Unpolarisiertes Licht wie z. B. Sonnenlicht ändert die Schwingungsrichtung und den Betrag seiner Feldvektoren hingegen willkürlich. Du kannst es aber durch einen Polarisationsfilter in polarisiertes Licht umwandeln.
Polarisationsfilter Funktion
Polarisiertes Licht kannst du mit Polarisationsfiltern erzeugen. Ein Polarisationsfilter besteht dabei aus einer Vielzahl von Molekülen, die in Molekülketten parallel zueinander angeordnet sind. Die optische Achse des Polarisationsfilters ist dann senkrecht zur Ausrichtung der Molekülketten.
Trifft eine elektromagnetische Welle auf die Molekülwand, passiert Folgendes: Der Teil der Welle, der in die gleiche Richtung schwingt wie die Molekülketten angeordnet sind, kann mit ihnen wechselwirken und wird sozusagen verschluckt. Der senkrecht zu den Molekülketten schwingende Teil wechselwirkt aber nicht mit ihnen und kann den Filter dann einfach durchdringen.
Hast du also zum Beispiel eine horizontale Molekülwand, dann wird eine horizontale Schwingungsrichtung absorbiert. Vertikal schwingende Feldvektoren treffen zwar auf die Moleküle, aber können mit ihnen nicht wechselwirken.
Daher kann dieser Anteil des Lichts seine Energie nicht übertragen und gelangt nahezu verlustfrei durch die Molekülwand.
Die Schwingungsrichtung, die durch den Polarisationsfilter ohne Absorption gelangen kann, definiert die Achse des Polarisationsfilters. Die Achse eines Polarisationsfilters ist demnach senkrecht zur Orientierung der Moleküle.
Studyflix vernetzt: Hier ein Video aus einem anderen Bereich
Polarisationsarten
Die verschiedenen Polarisationsarten kannst du je nachdem, wie sich die Schwingungsrichtung der elektrischen Feldvektoren und ihr Betrag verhalten, unterteilen:
- Lineare Polarisation: Die Schwingungsrichtung der elektrischen Feldvektoren ist konstant, der Betrag ändert sich jedoch periodisch.
- Zirkulare Polarisation: Hier ist der Betrag der elektrischen Feldvektoren zwar konstant, doch die Schwingungsrichtung ändert sich mit einer festen Winkelgeschwindigkeit .
- Elliptische Polarisation: Bei dieser Art der Polarisation ändern sich sowohl der Betrag der elektrischen Feldvektoren als auch die Schwingungsrichtung.
Die Polarisationsarten erhalten ihre Namen dadurch, dass bei Betrachtung von vorne der elektrische Feldvektor folgenden geometrischen Formen entspricht.
Bei der linearen Polarisation beispielsweise bewegt sich also der elektrische Feldvektor entlang einer Linie, bei der zirkularen Polarisation hingegen entlang eines Kreises.
Polarisation Anwendungen
Polarisation begegnet dir in verschiedensten Anwendungen im Alltag. Zum Beispiel in:
- Flüssigkristallanzeigen (auch LCD-Displays genannt),
- Sonnenbrillen,
- 3D-Filme,
- Spannungsanalyse an transparenten Kunststoffen und
- bei der Fotografie.
Mehrere Polarisationsfilter
Generell gilt, dass sich die Lichtintensität von unpolarisiertem Licht halbiert, wenn das Licht auf einen idealen Polarisationsfilter trifft.
Wenn du mehrere Polarisationsfilter hintereinander hast, entscheidet die Polarisationsrichtung der Filter, was passiert:
- Schickst du Licht durch zwei Polarisationsfilter mit gleicher Polarisationsachse (z. B. beide senkrecht, also Winkelunterschied von 0°), dann hat der zweite Filter keinen Effekt. Das Licht ist nach dem ersten Filter bereits vertikal polarisiert.
- Schickst du Licht durch einen Filter mit waagerechter Polarisationsachse und dann durch einen Filter mit senkrechter Polarisationsachse (Winkelunterschied von 90°), dann kann kein Licht passieren. Nach dem ersten Filter ist das Licht horizontal polarisiert und hat keinen vertikalen Anteil mehr. Der zweite Filter „schluckt“ das Licht.
- Schickst du Licht durch einen Filter mit waagerechter Polarisationsachse und dann durch einen Filter mit gedrehter Polarisationsachse (Winkelunterschied von z. B. 45°), dann ändert sich die Intensität und die Polarisationsrichtung des Lichts. Im ersten Filter wird das Licht zum Beispiel senkrecht polarisiert. Im zweiten Filter wird dann der senkrechte Anteil des polarisierten Lichts „geschluckt“. Der restliche Teil des Lichts, der also parallel zum zweiten Filter steht, wird dann in die Ausrichtung des zweiten Filters polarisiert und hat eine geschwächte Intensität.
Polarisation bei Reflexion
Eine weitere Möglichkeit, polarisiertes Licht zu erhalten, ist die Polarisation durch Reflexion. Dabei trifft der elektrische Feldvektor von unpolarisiertem Licht auf eine Grenzfläche zwischen zwei Medien (z. B. Luft und Glas) mit unterschiedlichem Brechungsindex .
Bei einem ganz bestimmten Winkel, dem sogenannten Brewster-Winkel (oder auch Polarisationswinkel)  besteht der reflektierte Strahl dann aus vollständig polarisiertem Licht. Der gebrochene Strahl ist dabei teilweise polarisiert. Experimentell konnte man feststellen, dass der reflektierte Strahl in einem rechten Winkel zum gebrochenen Strahl steht.
besteht der reflektierte Strahl dann aus vollständig polarisiertem Licht. Der gebrochene Strahl ist dabei teilweise polarisiert. Experimentell konnte man feststellen, dass der reflektierte Strahl in einem rechten Winkel zum gebrochenen Strahl steht.
Den Polarisationswinkel kannst du bei gegebenen Brechungsindizes n1 und n2 mithilfe des Brewster’schen Gesetz folgendermaßen ausrechnen
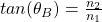 .
.
Lichtbrechung
Jetzt weißt du, dass du Polarisation auch durch Reflexion erhalten kannst. Wie du gesehen hast, wird ein Teil des Lichtstrahls dabei aber gebrochen. Möchtest du aber noch mehr über Lichtbrechung erfahren? Dann schau dir dazu unser Video an!



